Vier gewinnt
Das Team von Böge Lindner K2 Architekten über Wohnen im Park, Arbeiten nach dem Kant’schen Imperativ und darüber, wie man Schlimmeres verhindern kann
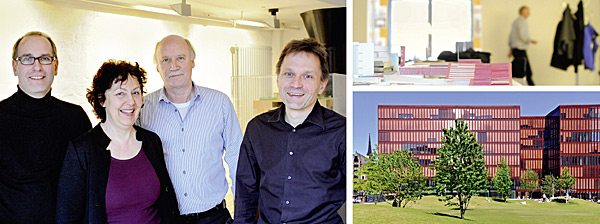
Architektengemeinschaft: Lutz-Matthias Keßling, Ingeborg Lindner-Böge, Jürgen Böge und Detlev Kozian (1). Die Büroräume am Brooktorkai (2). Bürohaus SKAI von Böge Lindner, fertiggestellt 2009 (3)
Als Sie 2001 an den Brooktorkai zogen, gab es die HafenCity erst auf dem Papier.
Böge: Wir sind von Anfang an dabei. Als wir hier einzogen, standen da unten noch das alte Zollamt, die kleine Polizeistation und die Kaffeesilos. Wir haben diese Anfangszeit praktisch live vor der Haustür miterlebt: den alten Bestand, die ersten Baufelder, die Baustellen – viele davon unsere eigenen!
Kozian: Wir haben hier unser eigenes Umfeld gestaltet. Wann kann man das schon?
Böge: Als wir 1997 von der HafenCity erfuhren, waren wir genauso überrascht wie alle anderen. Das war natürlich spannend, weil sich plötzlich ein riesiges Betätigungsfeld öffnete. Aber die logische erste Frage war eigentlich: Was wird in diesem Zusammenhang mit der Speicherstadt geschehen?
„Das Gute am Backstein ist: Er verhindert Schlimmeres. Er nivelliert in seinem Rahmen einigermaßen schlechte Bauten. Ein gutes Material, das man aber auch schlecht verwenden kann. Er ist auf jeden Fall kein Allheilmittel“
Sie konnten diese Frage selbst beantworten: Sie gehörten zu den Büros, die am Sandtorkai die ersten Gebäude der HafenCity gebaut haben.
Keßling: Richtig. Zu den Vorgaben gehörte unter anderem, dass das Gebäude ziegelbesetzt sein sollte. Wir fanden es prinzipiell positiv, an dieser Nahtstelle zwischen der Speicherstadt und der neuen HafenCity ein Gegenüber zu schaffen, das eine Verbindung über die Materialität schafft. Detlev Kozian hat damals lange nach dem richtigen Stein gesucht, der konform zur Speicherstadt sitzt. Interessant war an dieser Nahtstelle aber die Frage: Machen wir hier gestalterisch einen Bruch oder nicht?
Kozian: Städtebaulich gab es klare Vorgaben. Es handelt sich quasi um Punkthäuser, zwischen denen man hindurch die Speicherstadt oder aus der anderen Richtung den Kaiserkai sehen kann. Eine völlig andersartige Struktur, mit zweigeschossigen Loftwohnungen, aber doch ähnlich zur Speicherstadt. Beides sollte farblich und thematisch miteinander korrespondieren.
Böge: Die ersten Baufelder am Sandtorkai waren total stringent vorgegeben. Es gab keine Diskussionen über Ziegel, Kubus, die Sockelzonen oder die Abstände zwischen den Baukörpern. Das war alles völlig klar! Alle haben damals wahnsinnig geschimpft, dass man überhaupt keine Fantasie mehr haben dürfe! Aber wenn man heute das Ergebnis sieht, muss man sagen, dass die Bauten am Sandtorkai sicher nicht so monoton sind wie viele befürchtet haben.
Ist die Verwendung von Backstein in Hamburg in Ihren Augen eher Fluch oder eher Segen?
Böge: Das Gute am Backstein ist: Er verhindert Schlimmeres. Er nivelliert in seinem Rahmen einigermaßen schlechte Bauten (lacht). Ich würde das aber nicht mit Bedeutung aufheizen. Es ist ein Material wie jedes andere auch, ein gutes Material, das man auch schlecht verwenden kann. Es ist auf jeden Fall kein Allheilmittel. Allerdings muss ich auch sagen: Nach meinem Studium in Stuttgart stellte ich mir die Frage, wo ich hinwollte, wenn nicht in den Süden nach München. Für einen jungen Architekten mit Ambitionen stand da eigentlich nur Hamburg oder Berlin zur Debatte. Und wenn Sie sich an Berlin in dieser Zeit, in den 70er, 80er Jahren, erinnern: Die Stadt war graubraun von der Kohle, die die Haushalte zum Heizen verwendeten. Da fand ich es in Hamburg sehr angenehm, dass es wenigstens Ziegel gab.
Aber es war nicht der Grund, warum Sie sich für Hamburg entschieden haben?
Böge: Nach Berlin wollten wir damals nicht, weil es im geteilten Deutschland eine abgeschlossene Stadt war.
Ihr erstes selbstständiges Projekt war trotzdem in Berlin.
Böge: Unser erstes Projekt war 1980 eine Schule in Moabit, ein Projekt mit großem sozialem Anspruch. Über 50 Prozent der Schüler waren Kinder von Migranten, die meisten Türken. Es gab einen pädagogischen Modellgedanken, und den haben wir konkret in Architektur umgesetzt. Wir haben die Schule konzipiert wie eine kleine Stadt.

Büro von Böge Lindner K2 in der Speicherstadt (4). Jürgen Böge im Gespräch (5). Die markante rote Fassade des Bürogebäudes SKAI am Sandtorkai (6). ElbElysium mit Seniorenwohnungen am Kaiserkai (7)
Das war der Auftakt für eine ganze Reihe von Bildungseinrichtungen, die Sie seither realisiert haben, wie die Jacobs University in Bremen oder das Institut für Physik und Astronomie der Uni Potsdam. Aktuell sind Sie am Wettbewerb zum Campus Steilshoop beteiligt, mit Stadtteilschule und Quartierszentrum, und am Lohsepark sind die Arbeiten an einem Wohnprojekt im Gange, in dem auch ein Quartierstreff und eine Kindertagesstätte integriert werden. Bringen solche Mischnutzungen Konflikte mit sich, auf die man architektonisch reagieren muss?
Böge: Unter heutigen Gesichtspunkten handelt es sich nicht wirklich um ein gemischt genutztes Gebäude, nur weil im Erdgeschoss eine andere Nutzung vorgesehen ist als Wohnen. Das ist nur die erste Stufe von Mischnutzung. Richtig spannend wird es erst, wenn man das im größeren Zusammenhang sieht, also in den Auswirkungen für die Umgebung. Das beste Beispiel für ein gemischt genutztes Gebäude steht im Überseequartier, das Haus Virginia. Dort findet man Hotel, Wohnen, im Erdgeschoss Läden. Das kann man wirklich als Hybridgebäude bezeichnen. Trotzdem sieht es noch relativ einheitlich aus. Aber darin besteht natürlich die Herausforderung: Nutzungen so zu mischen, dass sie sich gegenseitig befruchten und nicht stören, also sie vernünftig zu mischen und nicht einfach nur zu mischen.
Prüfen Sie Ihre Gebäude hin und wieder im Rückblick darauf, ob sie funktionieren, ob sich Ihre Entwürfe in der Realität bewähren?
Böge: Wir bei Böge Lindner K2 kommen alle aus einer Zeit, in der Architektur auch etwas mit Sozialromantik oder Sozialutopie zu tun hatte. Wir schleppen diesen Anspruch immer mit wie eine Art Kant’schen Imperativ. Wenn ich ein Stück Erde in meine Verantwortung bekomme, wenn ich bauen darf, dann muss es hinterher schöner sein als vorher; es sollte die Welt ein bisschen im positiven Sinne verändert haben. Ich habe zum Beispiel lange Kontakt zu dieser Schule in Moabit gehalten. Nach dem Bau war dieses soziale Projekt sehr, sehr erfolgreich, inzwischen hat sich das aus verschiedenen Gründen geändert. Als ich vor ein paar Jahren zu einem Schulbaukongress eingeladen wurde, habe ich dieses alte Projekt herausgeholt und gesagt: Ich finde es total lästig, dass wir ständig neue Konzepte und Ansprüche formulieren, uns aber nicht mit unseren alten Versuchen beschäftigen. Das, was wir Architekten vor 30 Jahren gebaut haben, ist noch gar nicht ausgewertet worden! Ob es funktioniert oder nicht und warum nicht, weiß ich nur von den Lehrern, mit denen ich gesprochen habe.
Keßling: Ob Gebäude funktionieren, hängt ja auch von sehr unterschiedlichen Faktoren ab. Natürlich wird eine Verbindung wie zum Beispiel im Lohsepark, also öffentlicher Park, Kindertagesstätte und Wohnen, von einigen als Konfliktpotenzial verstanden. Ich glaube aber, dass man das nicht unbedingt als Konflikt begreifen muss.

Ocean’s End, eines der ersten Häuser am Sandtorkai (8). Detail- und Gesamtansicht vom Haus Virginia im Überseequartier (9 und 11). Modell der Gesamtschule Wilhelmsburg (10)
Wie können denn eine Kita und ein öffentlicher Park zusammen mit Wohnungen funktionieren?
Keßling: Am Lohsepark haben wir klar horizontal geschichtet: Weil Kinder nicht viel Treppen laufen können, ist die Kita in der Sockelzone, also im Erdgeschoss und in der ersten Galeriezone. Während die Katharinenschule die Spielfläche auf dem Dach hat, haben wir die Spielfläche im Hof organisiert: ein abgedeckeltes Spielgebäude, strukturiert wie ein Gittergarten, in dem die Kleinen frei spielen können. Ansonsten wird der Lohsepark selbst zum Spielgelände für die Kinder. Das ist dort auch nicht die einzige Kindertagesstätte, sondern in den nächsten Blöcken befinden sich, glaube ich, zwei weitere Kitas. Auf der Seite zur Steinschanze gibt es auch noch einen Quartierstreff im Bereich der Genossenschaftswohnungen, das heißt, die Nutzungen werden hier gestaffelt: Unten ist der öffentliche Bereich, in den oberen Stockwerken der private.
Kozian: Wohnen am Lohsepark wird zukünftig eine sehr schöne Adresse. Anders als die anderen Freiflächen in der HafenCity, die hauptsächlich über Wasserflächen und Kaiwandanlagen bestimmt sind, entsteht hier ein zentraler Park. Deshalb haben wir uns gefragt: Wie können wir den Parkrand gestalten?
Keßling: Beim Lohsepark hatten wir – anders als beim Haus Virginia, wo wir den ganzen Block formen durften und auf diese Weise auch die Blockränder bestimmen konnten – nur eine Teilfläche des Baufeldes, einen Baukörper in L-Form als eine Hälfte eines Karrees zu bearbeiten. Für dieses L gab es Vorgaben, zum Beispiel roter Ziegel, auch die Höhenstrukturen waren natürlich angegeben, die sich im Wesentlichen an den Bestandsbauten am Nordende des zukünftigen Parks orientieren.
Kozian: Wir haben also überlegen müssen, wie wir diese L-Figur gestalten, sodass wir einen Block bilden, der trotzdem Einzeladressen darstellt. Wir haben deshalb versucht, die Baumasse zum Park hin zu zergliedern, indem wir diese große Blockstruktur parzellieren und ein, zwei, drei Häuser schaffen. Das war das Prinzip. Darüber hinaus kam uns beim Wettbewerb die Fassadenthematik ganz gelegen, denn vor dem Block sollte ursprünglich noch für sechs Jahre die große Lagerhalle stehen, die jetzt zum Glück frühzeitig abgebrochen wurde, die aber für uns noch einen Entwurfsimpetus beinhaltete, weil wir seitlich Abstände einhalten mussten. Daraus sind dann teilweise diese Überkragungen am Eckbau entstanden. Man versteht das heute nicht mehr, denn die Halle ist weg. Trotzdem wirken diese Rücksprünge auch ohne die Halle nicht wie Provisorien, sondern werden im Gegenteil plötzlich zum Identifikationsmerkmal für die Einzelhaussituation.
Wenn Sie jetzt noch am Strandkai bauen würden, hätten Sie in der westlichen HafenCity in fast jedem Quartier Ihren Abdruck hinterlassen …
Böge: Am Strandkai haben wir damals die städtebauliche Überarbeitung gewonnen. „Gewonnen“ muss man allerdings in Anführungsstriche setzen. Es gab einen zweistufigen Wettbewerb für Unilever: In der ersten Phase ging es um den Städtebau, in der zweiten um das Gebäude. Wir haben das ziemlich kess aufgezogen, indem wir gesagt haben: „Der städtebauliche Entwurf, der vom Strandkai vorliegt, ist gut. Uns fällt auch kein besserer ein.“ Wir haben ihn deshalb im Prinzip so gelassen wie er war, nur ein bisschen über Materialität und Anmutung ergänzt und Unilever auf ein anderes Grundstück gestellt. Damit haben wir dann den städtebaulichen Wettbewerb gewonnen. Das war unser Beitrag zum Strandkai. Wir haben dann natürlich auf die weitere Bearbeitung verzichtet, weil das Konzept nicht von uns war, sondern von ASTOC. Aber jetzt nehmen wir wieder an den aktuellen Wettbewerben zum Strandkai teil.
Interview: Nikolai Antoniadis, Fotos: Thomas Hampel (3, 6, 7, 8, 9, 11), Jonas Wölk (1, 2, 4, 5, 10)



